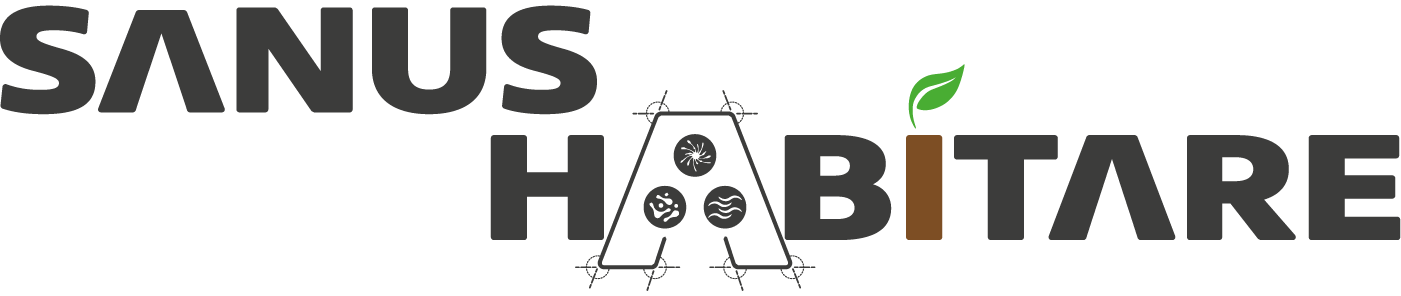Verbreitete Wohngifte und ihre Auswirkungen auf unsere Gesundheit
Wohngifte, auch als Innenraumschadstoffe oder Umgebungsschadstoffe bezeichnet, umfassen Dinge des alltäglichen Lebens. So z.B. Zigarettenrauch, Ausdünstungen von Baustoffen, Möbeln und Textilien, Abgase aus Industrie und Verkehr sowie Schimmelpilzsporen. Diese sind jedes Jahr mit steigender Tendenz weltweit für Millionen Todesfälle verantwortlich, da sind sich Forschende einig. Das Thema Wohngifte ist medizinisch kein unbeschriebenes Blatt und soweit erforscht, dass man vom Sick Building Syndrom (SBS) spricht, wenn diese krank machen.
Eine weitere gesundheitliche Beeinträchtigung, durch die tägliche Belastung mit solchen Innenraumgiften, besteht bei Patienten mit Multipler Chemikaliensensibilität (MCS), diese klagen über die Exposition durch Chemikalien, welche in den nachgewiesenen Konzentrationen normalerweise keine negativen Effekte hervorrufen. Studienergebnisse aus aller Welt zeigen, wie schädlich Wohngifte sein können und wie dringend notwendig Maßnahmen sind, um die Giftbelastung in Wohnräumen zu reduzieren.

Holzschutzmittel
Verschiedene von der Industrie verwendete Chemikalien, die Holz in Wohnräumen vor Pilzen, Insekten und anderen Schädigungen schützen sollen, sind...
Schimmel
Schimmel ist die allgemein gebräuchliche Beschreibung für Schimmelpilze. Diese sind völlig natürlich und ein unverzichtbarer...
Elektromagnetische Felder
Elektromagnetische Felder sind unsichtbare Bereiche von Energie, die durch Elektrizität erzeugt werden. EMF können in zwei...
Brand- und Flammschutzmittel
Was auf der einen Seite Leben schützen soll, ist leider auf lange Sicht eher gesundheitlich schädlich...
Lösemittel
Boden- und Wandbelägen, Farben und Lacken etc. mischt die Industrie bei der Herstellung Lösemittel bei, diese VOC-haltigen Lösemittel machen...
Formaldehyd
Formaldehyd ist bis heute ein wichtiges Basisprodukt der chemischen Industrie, hauptsächlich als Konservierungsstoff eingesetzt..
Weichmacher
Weichmacher sind in vielen Produkten wie Farben, Kunststoffgegenständen, Kinderspielzeugen und Boden- und Wandbelägen enthalten...
Radon
Radon ist ein natürlich vorkommendes radioaktives Gas, das aus dem Zerfall von Uran im Boden und Gestein entsteht. Es kann in Gebäude eindringen...
Hierzu hat das UBA eine Broschüre bzw. Publikationen veröffentlicht, die Links führen Sie direkt zum Downloadbereich:
Sie uns und schaffen gesunde Innenräume für Familie und Arbeit.
Lösemittel in Bodenbelägen, Farben, Lacken und Reinigungsmitteln, sind ebenfalls Wohngifte
Boden- und Wandbelägen, Farben und Lacken etc. mischt die Industrie bei der Herstellung Lösemittel bei, diese VOC-haltigen Lösemittel machen sie z.B. leichter sprüh-, streichbar und damit besser Verarbeitungsfähig.
Häufige Quellen für VOC in Innenräumen sind auch Bauprodukte oder die Innenausstattung, wie beispielsweise Fußboden-, Wand- und Deckenmaterialien und Möbel.
VOC (Volatile Organic Compounds), teils natürlichen Ursprungs sind flüchtige organische Verbindungen, hierzu zählen z.B. Kohlenwasserstoffe, Alkohole und organische Säuren.
Starke Konzentrationen dieser Ausdünstungen (Wohngiften), können angefangen mit Kopfschmerzen, Atemwegserkrankungen, Allergien, brennenden Augen und allgemeinem Unwohlsein auch Krebserkrankungen auslösen.
Eine langfristige Überkonzentration schädlicher VOC schädigt Nieren, Leber, Nerven und das Knochenmark und fördert die Tumorbildung.
Da solche flüchtigen organischen Verbindungen auch lange Zeit nach dem einbringen in dieRäume noch in die Luft ausgasen können, sollte beim Kauf unbedingt auf wohngesunde emissionsarme Produkte geachtet werden.
Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) führt Prüfungen u.a. von Farben, Klebstoffen, Lacken und Boden- und Wandbelegen durch, da es sich hier aber immer nur um Einzelbetrachtungen handelt, ist es wichtig alle in den Räumen befindlichen möglichen Quellen zu prüfen. Stehen viele mit VOC belastete Gegenstände in den Innenräumen, addiert sich die Konzentration der Ausdünstungen.
Hierzu hat das UBA Publikationen bzw. Broschüren veröffentlicht, die Links führen Sie direkt zum Downloadbereich:
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/geruchsbeschwerden-in-innenraeumen-auswertung-von
um mehr über unsere Dienstleistungen zu erfahren und einen Termin zu vereinbaren. Gemeinsam schaffen wir Wohlfühlräume.
Formaldehyd in Holzwerkstoffen und Wohntextilien
Formaldehyd gehört zu den häufigen Wohngiften und ist bis heute ein wichtiges Basisprodukt der chemischen Industrie. Hauptsächlich wird es als Konservierungsstoff eingesetzt. Es ist Ausgangsstoff vieler Kunstharze und Leime, die für Wohntextilien und Holzwerkstoffplatten verwendet werden. Mit der vermehrten Verwendung von Holzwerkstoffen wie Faserpressplatten, Span- oder Sperrholz und MDF nahm auch die Verwendung von Formaldehyd erheblich zu.
Traurige Berühmtheit erlangten insbesondere Spannplatten mit sehr hohen Ausgasungswerten, bis heute gibt es Fertigbauhäuser mit besorgniserregenden Werten.
Für Holzwerkstoffplatten wurden deshalb Formaldehyd-Emissionsklassen festgesetzt, so bedeutet:
F 0 enthält kein Formaldehyd, stattdessen aber gebundene Isocyanate.
Die Emmissionsklasse E 1 bezeichnet geringe Emissionen, unter Laborbedingungen sollen nicht mehr als 0,1 ml/m3 (entspricht 0,1 ppm (parts per million) bzw. 124 µg/m3) Formaldehyd in der Raumluft entstehen. Unter Realbedingungen ist dies allerdings nicht immer realistisch und wird häufig überschritten.
Da Formaldehyd sehr langsam aus den Materialen ausgast, wird die Innenraumluft langfristig belastet. Auch hier gilt, stehen viele mit Formaldehyd belastete Gegenstände in den Innenräumen, addiert sich die Konzentration der Ausgasungen.
Hierzu hat das UBA eine Broschüre bzw. Publikationen veröffentlicht, die Links führen Sie direkt zum Downloadbereich:
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/leitfaden-zur-umweltfreundlichen-oeffentlichen-7
um mehr über unsere Dienstleistungen zu erfahren und wie wir Ihnen helfen können.
Schimmel in Gebäuden
Schimmel ist die allgemein gebräuchliche Beschreibung für Schimmelpilze. Diese sind völlig natürlich und ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Umwelt und üblicherweise harmlos. Übersteigt die Konzentration von Schimmelpilzen jedoch ein bestimmtes Maß, können diese zu gravierenden gesundheitlichen Problemen für den Menschen führen. Die Auswirkungen von Schimmelpilz, in Innenräumen unserer Gebäude, auf die menschliche Gesundheit sind ein vielfach diskutiertes, aber ein unterschätztes Wohngift in der Gesellschaft. Schimmelpilzbefall in unseren Lebens- und Wohnumfeld entsteht primär durch Feuchtigkeit z.B. durch unzureichenden Luftaustausch. Deshalb sind häufig Feuchträume, beispielsweise innenliegende Badezimmer, betroffen. Erkennbar ist Schimmel z.B. durch modrigen Geruch.
An befallenen Wänden oder Möbeln bilden sich während der Schimmelblüte unterschiedlich farbige Punkte bzw. Flächen. Die eine Ursache für Schimmelpilzbefall in Gebäuden gibt es leider nicht. Die Gründe für Schimmelbefall sind vielfältig. Manchmal treffen auch mehrere gleichzeitig zu. Der Befall mit Schimmelpilz ist auch nicht immer offensichtlich und hat sich schon geraume Zeit ausgebreitet bevor erste Anzeichen wahrnehmbar werden. Die größte Gefahr der Schimmelpilzbildung besteht im Winter, da kalte Luft weniger Feuchtigkeit aufnimmt und diese dann an kalten Oberflächen und Wänden kondensiert und sich ansammelt. Deshalb ist in der kalten Jahreszeit eine ausreichende und gleichmäßig über den Tag verteilte Lüftung der Räume notwendig.
Hierzu hat das UBA eine Broschüre veröffentlicht, der Link führt Sie direkt zum Downloadbereich:
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/leitfaden-zur-vorbeugung-erfassung-sanierung-von
aufnehmen und entdecken wie sie Lebens- und Wohnqualität verbessern können. Unsere Expertise für ihr gesundes Wohn- und Arbeitsumfeld.
Weichmacher
Weichmacher sind in vielen Produkten wie Farben, Kunststoffgegenständen, Kinderspielzeugen und Boden- und Wandbelägen enthalten. Weichmacher sind Chemikalien, die spröden Materialien beigemischt werden, um sie weich, biegsam oder dehnbar zu machen, damit sie einfacher zu bearbeiten sind oder bestimmte Nutzungseigenschaften erreichen. Lange bekannte Nachteile dieser Wohngifte sind die Wirkungsweise auf den menschlichen Organismus sie lösen Allergien, Unfruchtbarkeit und Krebs aus.
Sogar durch schlichte Berührung mit der Haut können die Schadstoffe vom Körper aufgenommen werden. Insbesondere für Kinder ist Vorsicht geboten, das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW hat Urinproben von Kindergartenkindern aus den Jahren 2017/2018 mit Proben von 2020/2021 verglichen. Innerhalb von nur 3 Jahren stieg der Anteil der belasteten Proben von 26 auf 61 Prozent. Hier wurden auch Rückstände von bereits verbotenen Stoffen festgestellt. Besondere Vorsicht ist vor allem bei billigen Spielzeugen aus PVC, Kinderkleidung aus Asien und PVC-Böden geboten, die bis zu 30 Prozent aus Weichmachern bestehen können. Selbst im Hausstaub werden größere Konzentrationen nachgewiesen.
Hierzu haben das UBA, das LANUV und die Verbraucherzentrale jeweils Publikationen veröffentlicht, der jeweilige Link führt Sie direkt zu den Veröffentlichungen:
https://www.lanuv.nrw.de/suche?tx_kesearch_pi1%5Bsword%5D=weichmacher
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/verbotener-weichmacher-im-urin-von-kitakindern-ursache-sonnencreme-93237
Holzschutzmittel
Verschiedene von der Industrie verwendete Chemikalien, die Holz in Wohnräumen vor Pilzen, Insekten und anderen Schädigungen schützen sollen, sind für die Bewohner gesundheitsschädigend.
Holzschutzmittel können in allen Holzprodukten vorkommen, beispielsweise in Kinderspielzeugen, Holzmöbeln, Dielen oder dem Dachstuhl des Gebäudes. Manche Holzschutzprodukte gasen regulär aus und ihre Bestandteile gelangen so in die Raumluft und werden über die Atmung aufgenommen.
Hierzu gehören unter anderem:
- Dichlordiphenyltrichlorethan, (DDT)
- Lindan
- Pentachlorphenol, (PCP) und
- Terpentinöl
DDT, Lindan und PCP werden als krebserregend eingestuft. Holzschutzmittel mit Terpenen können Haut und Nervensystem schädigen. Erste Symptome sind Hautallergien wie Ausschlag und Rötungen, Kopfschmerzen und gereizte Schleimhäute.
Obwohl DDT, PCP und Lindan seit geraumer Zeit in der EU nicht mehr in Holzschutzmittel verwendet werden dürfen, können diese über Produkte aus dem außereuropäischen Raum in den Handel gelangen.
Hierzu hat das UBA eine Broschüre bzw. Publikantionen veröffentlicht, die Links führen Sie direkt zum Downloadbereich:
https://www.umweltbundesamt.de/giftige-holzschutzmittel-im-garten
Sie uns gerne, um mehr über unsere Dienstleistungen zu erfahren und einen Termin zu vereinbaren. Gemeinsam schaffen wir Wohlfühlräume.
Brand- und Flammschutzmittel in Dämmstoffen und Textilien
Was auf der einen Seite Leben schützen soll, ist leider auf lange Sicht eher gesundheitlich schädlich.
Als Brand- und Flammschutzmitteln werden eine Vielzahl verschiedener organischer und anorganischer Chemikalien eingesetzt.
Die schädlichen Stoffe können aus den behandelten Produkten entweichen und sich als Wohngifte in der Innenraumluft anreichern und/ oder im Hausstaub niederschlagen und das menschliche Nervensystem schädigen, zur Unfruchtbarkeit und zu Krebserkrankungen führen.
Brennbaren Materialien wie Kunststoffen und Textilien zugesetzt, sollen sie diese schwerer entflammbar machen. Gegenwärtige wissenschaftliche Untersuchungen belegen jedoch, dass diese synthetischen Flammschutzmittel die Toxizität des entstehenden Rauches bei Bränden in stärkerem Maße erhöhen, als sie die Entflammbarkeit der behandelten Materialien reduzieren können.
Hierzu haben das UBA und die Bundesländer diverse Broschüre bzw. Publikantionen veröffentlicht, die Links führen Sie direkt zum Downloadbereich:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3521.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2921.pdf
Radon
Radon ist ein natürlich vorkommendes radioaktives Gas, das aus dem Zerfall von Uran im Boden und Gestein entsteht. Es kann in Gebäude eindringen und dort in hoher Konzentration gesundheitsschädlich sein. Da radonhaltige Bodenluft ausgast und so über den Baugrund in die Gebäude eindringt, kommt es nahezu überall vor. Entscheidend ist die Radon-Konzentration, während der Jahresmittelwert bei 65 Becquerel pro Kubikmeter liegt, gehen aktuelle Studien davon aus, dass ca. 2 Millionen Menschen mit über 300 Becquerel pro Kubikmeter belastet werden.
Als Faustregel gilt, pro 100 Becquerel je Kubikmeter Raumluft langjähriger Radon-Konzentration erhöht sich das Lungenkrebsrisiko um etwa 16 %. Mit Inkrafttreten des StrlSchG zum 31.12.2020 sind die Bundesländer verpflichtet Radonvorsorgegebiete festzulegen. Dies gilt für Gebiete wo erwartet wird, dass die über das Jahr gemittelte Radonkonzentration in der Luft von Gebäuden mit Wohnräumen bzw. Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter überschreitet.
In den letzten Jahren wurde diesem Thema verständlicherweise erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet und eine Karte erstellt, in der Gebiete mit erhöhter Belastung aufgeführt sind.
Der Fachverband f. Strahlenschutz e.V. hat hierzu Servicelink, der die Karte nach Bundesländern ordnet: https://www.fs-ev.org/radonvorsorgegebiete
Radon in Gebäuden
b) Gesundheitsrisiken
Langfristige Exposition gegenüber hohen Radonkonzentrationen erhöht das Risiko für Lungenkrebs. Radon ist nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs.
a) Entstehung und Vorkommen
Radon entsteht durch den radioaktiven Zerfall von Uran, das in Böden und Gesteinen weit verbreitet ist. Das Gas dringt durch Risse und Spalten in den Fundamenten sowie durch undichte Stellen in den Wänden und Böden in Gebäude ein.
Das Risiko ist besonders hoch bei Rauchern, da die kombinierte Exposition das Krebsrisiko noch weiter erhöht.
Maßnahmen zur Reduzierung von Radon in Gebäuden:
Die Verbesserung der Lüftung ist, wie in so vielen Fällen ein probates Mittel zur Reduzierung der Radonbelastung.
Bevor Maßnahmen ergriffen werden, sollte die Radonkonzentration im Gebäude gemessen werden. Diese sollten in den Wintermonaten eingesetzt werden, da dann die Konzentrationen am höchsten sind. Es gibt Kurzzeitmessungen (2-7 Tage) und Langzeitmessungen (90 Tage bis 1 Jahr).
Es erübrigt sich zu sagen, dass Langzeitmessungen aussagekräftiger sind, die Kurzzeitmessungen sind ein Indikator um eventuell weitere Maßnahmen zu ergreifen.
a) Natürliche Belüftung
Regelmäßiges Lüften durch Öffnen von Fenstern und Türen kann helfen, die Radonkonzentration zu reduzieren, ist jedoch weniger effektiv als mechanische Systeme.
b) Mechanische Belüftung
Installation von Lüftungssystemen, die die Luft im Gebäude austauschen und die Radonkonzentration senken.
c) Abdichtung von Rissen und Spalten
Versiegelung von Rissen und Öffnungen in den Fundamenten und Wänden kann das Eindringen von Radon reduzieren. Es gibt eine Vielzahl von speziellen Dichtungsmaterialien und -techniken, die für Radonabdichtung geeignet sind.
d) Unterdrucksysteme (Sub-Slab-Depressurization)
Installation von Systemen, die den Druck unter dem Fundament senken und das Radongas nach außen absaugen, bevor es ins Gebäude eindringen kann. Diese Systeme bestehen in der Regel aus einer oder mehreren Rohren, die unter das Fundament führen, und einem Ventilator, der das Radon nach außen abführt.
e) Radonabsaugsysteme (Active Soil Depressurization)
Die Funktion ist ähnlich wie die der Unterdrucksysteme, aber sie beinhalten oft zusätzliche Rohre und Ventilatoren, um eine stärkere Absaugung zu ermöglichen. Diese Systeme sind besonders effektiv in Gebäuden mit hohem Radongehalt.
f) Präventive bauliche Maßnahmen bei Neubauten
Bei Neubauten können spezielle radonhemmende Bauweisen und Materialien eingesetzt werden, um das Eindringen von Radon zu verhindern. In radonbelasteten Gebieten ist es nicht nur ratsam, sondern teilweise Vorgeschrieben, von Anfang an entsprechende Vorkehrungen zu treffen.
Bei Neubauten können spezielle radonhemmende Bauweisen und Materialien eingesetzt werden, um das Eindringen von Radon zu verhindern. In radonbelasteten Gebieten ist es nicht nur ratsam, sondern teilweise Vorgeschrieben, von Anfang an entsprechende Vorkehrungen zu treffen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, das Radon ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko in Gebäuden, insbesondere in bestimmten geologischen Regionen. Die Messung der Radonkonzentration ist der erste Schritt zur Einschätzung des Risikos. Je nach Messergebnis können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, um die Radonbelastung zu reduzieren. Diese reichen von verbesserten Lüftungssystemen über Abdichtungen bis hin zu komplexeren technischen Lösungen wie Unterdrucksystemen. Es ist wichtig, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit und Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
Hierzu hat das UBA und Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) Publikationen bzw. Broschüren veröffentlicht, der Link führt Sie direkt zum Downloadbereich:
Sie uns und ihr Zuhause zu einem gesunden Rückzugsort machen. Unsere baubiologische Expertise hilft dabei.
Elektromagnetische Felder (EMF)
Elektromagnetische Felder sind unsichtbare Bereiche von Energie, die durch Elektrizität erzeugt werden. EMF können in zwei Hauptkategorien unterteilt werden: niederfrequente Felder und hochfrequente Felder. In Gebäuden können EMF aus verschiedenen Quellen stammen und unterschiedliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Wie bei allen gesundheitlich beeinträchtigenden Ursachen sind auch bei elektromagnetischen Feldern die Menschen unterschiedlich empfindlich bzw. anfällig. Während die eine Gruppe überhaupt keine Auswirkungen empfindet, gibt andere die schon bei geringster Belastung körperliche Beschwerden haben.
Quellen von EMF in Gebäuden
a) Niederfrequente Felder (ELF-EMF)
Stromführende Leitungen: Die elektrischen Leitungen in den Wänden des Gebäudes und Außenstromleitungen erzeugen niederfrequente elektromagnetische Felder.
Elektrische Geräte: Kühlschränke, Waschmaschinen, Föhns, Mikrowellenherde, Computer, Lampen und andere Haushaltsgeräte.
b) Hochfrequente Felder (RF-EMF)
Mobiltelefone und Mobilfunktürme: Diese Geräte und Türme senden und empfangen hochfrequente Signale.
WLAN-Router: Drahtlose Netzwerke in Gebäuden erzeugen hochfrequente Felder.
Bluetooth-Geräte: Alle Bluetooth-fähigen Geräte erzeugen ebenfalls hochfrequente EMF.
Mikrowellenherde: Während des Betriebs emittieren sie hochfrequente Strahlung.
Die Forschung zu den gesundheitlichen Auswirkungen von EMF ist noch nicht abgeschlossen, und es gibt unterschiedliche Meinungen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft.
Einige potenzielle Gesundheitsrisiken und Auswirkungen sind:
a) Krebsrisiko
Es gibt einige Studien, die nahelegen, dass eine langfristige Exposition gegenüber hochfrequenten EMF (wie von Mobiltelefonen) das Risiko für bestimmte Krebsarten, insbesondere Hirntumoren, erhöhen könnte. Die Beweislage ist jedoch nicht eindeutig, und viele Studien haben keine schlüssigen Beweise erbracht.
b) Schlafstörungen
Einige Menschen berichten von Schlafproblemen, die sie auf EMF-Exposition zurückführen.
c) Kopfschmerzen und Schwindel
Es gibt Berichte über Kopfschmerzen, Schwindel und andere unspezifische Symptome bei Menschen, die EMF ausgesetzt sind.
d) Elektrosensibilität
Eine kleine Anzahl von Menschen berichtet, empfindlich auf elektromagnetische Felder zu reagieren und verschiedene Symptome zu erleben, obwohl die wissenschaftliche Grundlage hierfür umstritten ist.
Ob man nun empflindlich für EMF ist oder nicht empfiehlt es sich Maßnahmen zur Reduzierung der EMF-Belastung zu beachten:
a) Minimierung der Nutzung von Hochfrequenzgeräten
Reduzieren der Nutzung von WLAN, Mobiltelefonen und Bluetooth-Geräten, wenn sie nicht benötigt werden.
b) Abstand halten
Halten Sie einen sicheren Abstand zu elektrischen Geräten, insbesondere beim Schlafen. Verwenden Sie Kopfhörer oder Lautsprecher, um die direkte Exposition gegenüber Mobiltelefonen zu verringern.
c) Abschirmung
Verwenden Sie EMF-Abschirmprodukte wie spezielle Faraday-Gewebe oder -Vorhänge, um die EMF-Belastung zu reduzieren.
d) Verkabelte Verbindungen
Verwenden Sie kabelgebundene Internetverbindungen anstelle von WLAN, um hochfrequente EMF zu vermeiden.
e) Elektrische Geräte ausschalten
Schalten Sie elektrische Geräte aus, wenn sie nicht in Gebrauch sind, insbesondere während der Nacht. Dies hilft übrigens nicht nur der Gesundheit, sondern entlastet die Umwelt und auch das Portemonnaie.
EMF-Messung
Sie vermuten in ihrem Umfeld erhöhte Strahlung oder haben damit einhergehende Beschwerden? Wir haben entsprechende EMF-Messgeräte, um die Intensität der elektromagnetischen Felder in Ihrem Zuhause zu bestimmen und Hotspots zu identifizieren.
Es ist wichtig, einen ausgewogenen Ansatz zu verfolgen und sich nicht unnötig zu sorgen. Die meisten wissenschaftlichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Exposition gegenüber EMF in alltäglichen Situationen relativ gering ist und keine unmittelbare Gesundheitsgefahr darstellt. Dennoch kann es sinnvoll sein, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, insbesondere wenn Sie oder Ihre Familie empfindlich auf EMF reagieren.
Erste Maßnahmen zur Reduzierung von Wohngiften:
a) Regelmäßiges Lüften
Frische Luft reduziert Schadstoffkonzentrationen.
b) Verwendung schadstoffarmer Produkte
Achten auf Siegel wie „Blauer Engel“ oder „ECARF“.
c) Feuchtigkeitskontrolle
Vermeidung von Schimmel durch richtiges Heizen und Lüften, Beseitigung von undichten Stellen.
d) Asbestsanierung
Professionelle Entfernung in älteren Gebäuden.
e) Filterung und Reinigung der Luft
Einsatz von Luftreinigern und Pflanzen, die Schadstoffe filtern können.
f) Radonmessung
In Regionen mit hoher Radonbelastung entsprechende Messungen und bauliche Maßnahmen.
Überschlägig lässt sich sagen, dass wir im Durchschnitt 80 – 90 % unserer. Lebenszeit in Innenräumen verbringen. Deshalb ist es wichtig, sich der potenziellen Risiken bewusst zu sein und präventive Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden und am Arbeitsplatz zu gewährleisten.
Hierzu haben das UBA und UMID Broschüren bzw. Publikantionen veröffentlicht, die Links führen Sie direkt zum Downloadbereich:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/515/publikationen/umid0109.pdf
Termin absprechen und entdecken wie sie Lebens- und Wohnqualität verbessern können. Unsere Expertise für ihr gesundes Wohn- und Arbeitsumfeld.